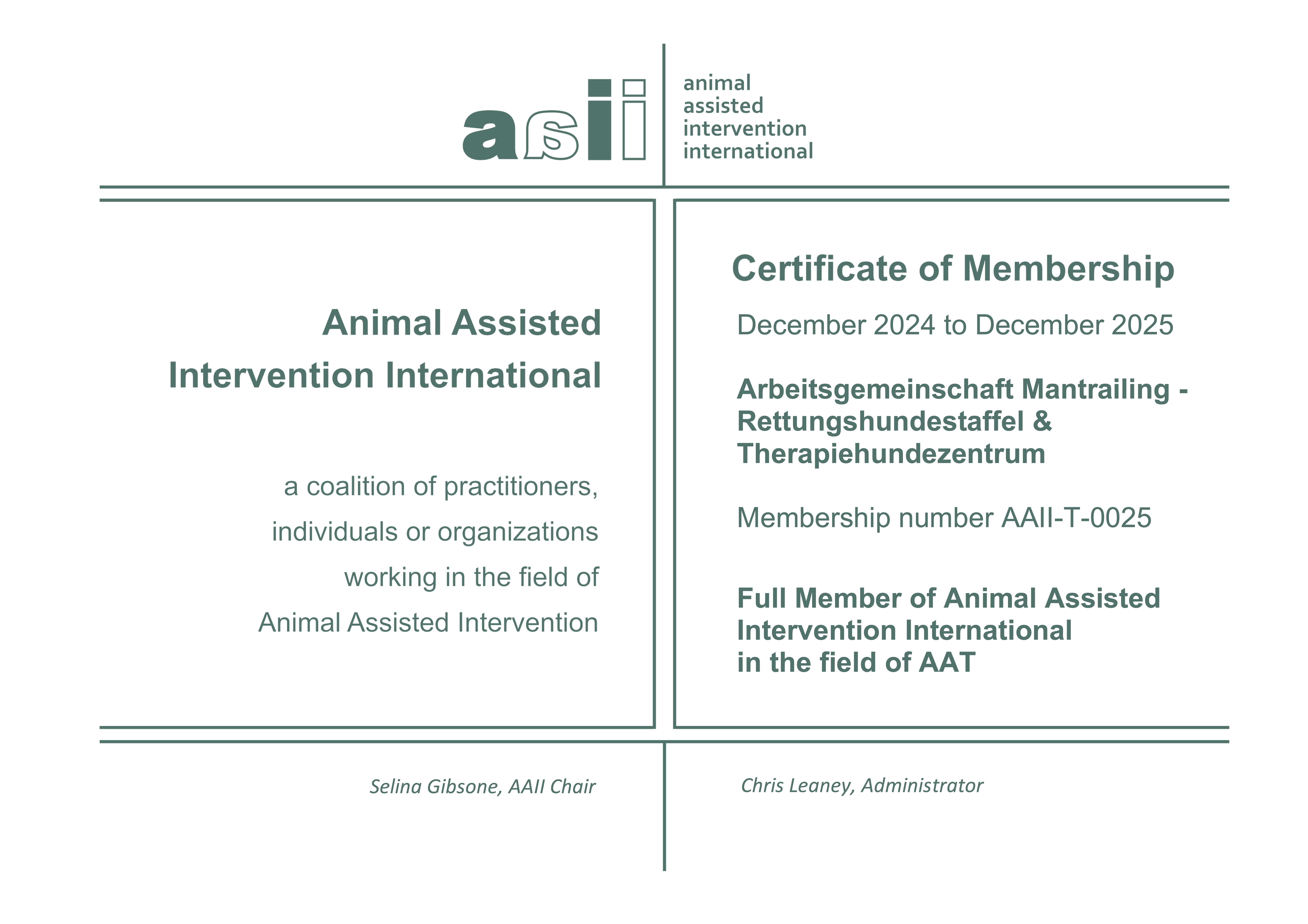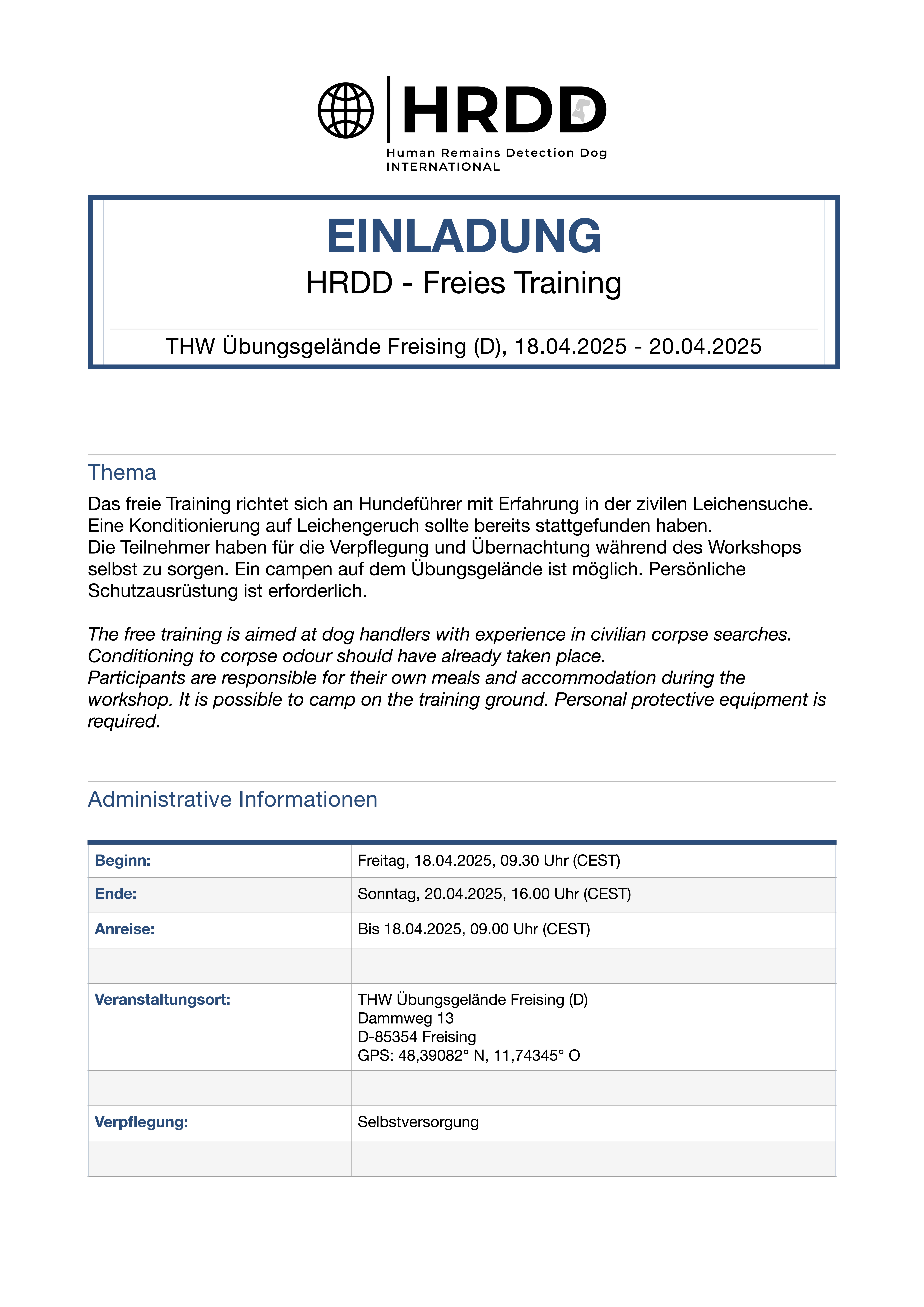Hundegebell: Was ist wann und wie lange erlaubt?
Bellen ist für Hunde ein Kommunikationsmittel und liegt in der Natur der Tiere. Bellt ein Hund aber besonders häufig oder lange, kann dies zu Streitigkeiten mit den Nachbarn führen. Die Frage ist: Wann ist Hundegebell als Ruhestörung einzustufen und was müssen Mitbewohner einfach erdulden? Verschiedene Gerichtsurteile geben Antworten.
Ob vor Freude, weil der geliebte Mensch nach Hause kommt oder vor Aufregung, wenn der Postbote an der Haustür klingelt: Mit ihrem Bellen drücken Hunde Emotionen aus. Vielen Rassen liegt es im Blut, Geräusche lautstark zu melden – manchmal zum Unmut des Nachbarn, der die Lautäußerungen als Lärmbelästigung empfinden kann. Damit haben sich bereits diverse Gerichte beschäftigt. Das übereinstimmende Urteil: Auch für Hundegebell gelten Richtlinien, Regeln und Ruhezeiten.
Wie viel und wie lange dürfen Hunde bellen? „Das Urteil des Oberlandesgericht Köln vom 7. Juni 1993 wird mittlerweile als Standardurteil in Lärmangelegenheiten verwendet“, erklärt der auf Tierrecht spezialisierte Anwalt Andreas Ackenheil. Dieses Urteil mit dem Aktenzeichen 12 U 40/93 verpflichtete einen Hundehalter, sein Tier so zu halten, dass Hundegebell, Winseln oder Jaulen auf dem Grundstück des Nachbarn zu bestimmten Ruhezeiten nicht zu hören ist. Diese Zeiten gelten von 13 bis 15 Uhr sowie von 22 bis 6 Uhr. Darüber hinaus darf Hundegebell nicht länger als zehn Minuten ununterbrochen und insgesamt 30 Minuten täglich zu hören sein. „Natürlich können festgesetzte Bellzeiten einem Hund nicht verständlich gemacht werden, daher sind die Regelungen eher als Orientierung zu verstehen“, erklärt der Tierrechtsexperte.
Auch in ländlicher Umgebung muss ein Hundehalter sicherstellen, dass Nachbarn vor 7 Uhr morgens, zwischen 13 und 15 Uhr und nach 22 Uhr keiner Lärmbelästigung durch Hundegebell ausgesetzt sind. Das Recht der Nachbarn auf Ruhe hat hier Vorrang vor dem Interesse des Hundehalters, wie das Landgericht Mainz am 22. Juni 1994 unter dem Aktenzeichen 6 S 87/94 urteilte.
Dürfen Hunde an Sonn- und Feiertagen bellen? „Geht von einer Hundehaltung eine erhebliche Lärmbelästigung durch das Hundegebell aus, so kann die Ordnungsbehörde anordnen, dass die Hunde nachts und an Sonn- und Feiertagen in geschlossenen Gebäuden gehalten werden. Diese Maßnahme ist angesichts des ordnungswidrigen Verhaltens des Hundehalters zulässig“, erläutert Anwalt Ackenheil. Dies hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am 5. Juli 2013 unter dem Aktenzeichen 11 ME 148/13 entschieden. Begründet wurde das Urteil damit, dass häufiges, übermäßig lautes und langanhaltendes Hundegebell, insbesondere zu Ruhezeiten wie der Mittags- und Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen, eine erhebliche Belästigung der Nachbarschaft und damit eine Ordnungswidrigkeit darstellt.
Besteht ein Anrecht auf Mietminderung? „Andere Mieter können die Miete wegen nachbarlichen Hundegebells allenfalls dann mindern, wenn der Hund regelmäßig und langanhaltend laut bellt. Gelegentliches Bellen stellt keinen Grund für eine Mietminderung dar“, sagt der Anwalt unter Berufung auf ein Urteil des Amtsgerichts Hamburg vom 6. März 2005 mit dem Aktenzeichen 49 C 165/05. Das Gericht führte aus, dass ein gelegentliches Bellen noch nicht als Mietmangel bezeichnet werden könne – ebenso wenig wie andere, mit der Wohnnutzung zwangsläufig verbundene nachbarliche Laute wie Schritte, das Rauschen einer Dusche oder Toilettenspülung. Derartige Geräusche gehören ebenso wie die Lebenszeichen eines Hundes zu dem Geräuschspektrum, das jeden Mieter eines Mehrfamilienhauses erwarte.
Aus einem weiteren Urteil des Amtsgerichts Rheine vom 3. Februar 1998 mit dem Aktenzeichen 14 C 731/97 geht hervor, dass Mieter, die wegen Hundegebells in der Nachbarswohnung die Miete mindern, in einem Prozess konkret darlegen müssen, zu welchen Zeiten der Hund hörbare Geräusche von sich gegeben hat.
Um Konflikte in der Nachbarschaft zu vermeiden, ist es daher nicht nur hilfreich, frühzeitig das Gespräch zu suchen. Der Hundehalter sollte auch Ursachenforschung betreiben und gemeinsam mit dem Vierbeiner daran arbeiten – gegebenenfalls auch mithilfe eines Hundetrainers. IVH